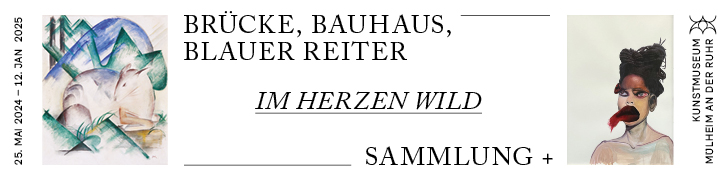Parookaville, das Festival in der selbsternannten „City of Dreams“ beim Airport Weeze, wo – zumindest laut der Online-Selbstbeschreibung – „Menschen Kontakt mit ihrem reinen Selbst aufnehmen, wahre Verbindungen erleben und ein tiefes Gefühl von Glückseligkeit und Erfüllung verspüren können.“ STROBO-Reporter Lennart Rettler und Torben Kassler haben sich einen Tag aufs Festival gewagt und sind auf der Suche nach der Ruhrpott-Hymne und ihres Verfassers an die Grenzen ihrer Kapazitäten gestoßen – körperlich und mental.
„Wozu brauchen wir Frankfurt, Berlin oder Köln, New York, London oder Rotterdam, wo wir doch unser wunderschönes Bottrop haben?“ Das fragt der damals 25-jährige DJ Hooligan, inzwischen 54 Jahre alt und bekannt unter dem Namen Da Hool – bürgerlich Frank Tomiczek –, bevor dreckige Drums und eine bis an ihre Grenzen ausgereizte Roland 303 die inoffizielle Hymne der Ruhrgebietsperle Bottrop einläuten: den 1993er Banger „B.O.T.T.R.O.P“. In den kleinen Clubs des Ruhrgebiets ist Da Hool heute seltener anzutreffen, spielt er doch eher auf den großen Bühnen des Landes. Wozu also Kunstausstellungen in Dortmund, Theaterstücke in Essen oder Poetry Slams in Bochum, wo man doch auch zwei STROBO-Reporter aufs Parookaville schicken kann?
Grotesk zu Tode amüsieren
Unsere Reise zum Parookaville beginnt standesgemäß. Am Düsseldorfer Hauptbahnhof wird erstmal für Reiseproviant gesorgt: Etwas Bier, ein bisschen Treibstoff für die festliche Grundstimmung. Der Zug der uns nach Weeze bringen soll, weist schon die ersten Hinweise für den Tenor dieses Festivals auf. Männer der Kategorie Sales-Abteilung eines mittelständischen Unternehmens, Frauen zwischen 18 und 35 mit Malibu-Dosen bewaffnet und ein latenter Kotzegeruch in der Luft, der aus dem abgesperrten RE-Klo durchs Abteil weht.
In der knappen Stunde Fahrt planen wir unseren Tag, unser angestrebtes Motto, angelehnt an Neil Postman: „Wir amüsieren uns zu Tode“. Jedoch wollen wir unsere musikalische Energie für Da Hool aufsparen, mit dem wir vor seinem Auftritt um 20 Uhr ein Interview vereinbart haben. Wir setzen uns also das Ziel: Vermeidung jeglicher Musik-Acts bis zu Da Hools Auftritt um 20 Uhr. Der Vorteil dabei für uns: Wir können uns vollständig der attraktionsgeladenen Atmosphäre hingeben.
Nach der Registrierung als Bürger des Parookavilles schlendern wir über das Gelände. Schnell ist das Adjektiv des Tages gefunden: grotesk. Alles ist irgendwie grotesk. Oder groß. Oder grotesk groß. Da wäre zum Beispiel die an einen Star Wars AT/AT erinnernde Jägermeister-Bar, deren zweiter Stock eine maximal überdimensionierte Jägermeister-Flasche mit Blick auf eine der gigantischen Bühnen ist: grotesk. Schräg gegenüber die Wodka Gorbatschow-Bar im Stil eines Riesen-Schiffs (der „Icebreaker One”): grotesk. Die Warsteiner-Hochzeitskapelle: grotesk. Das festival-eigene Schwimmbad inklusive DRK-Rettungsschwimmer: grotesk. Das Merkur Automaten-Spielcasino: grotesk. Der Penny-Markt mit eigener Penny-Markt-Stage: grotesk. Grotesk, grotesk, grotesk. Wir versuchen der alles dominierenden Präsenz von Alkohol, Markenwerbung und Instagram-Spots zu entkommen, die das Festivalgelände ausmacht und flüchten auf den Zeltplatz. Kleiner Spoiler: grotesk!

Zwischen Katerfly, Minigolf und Kreisliga-Fußballtrikots
Nun, Zeltplätze auf Festivals sind sicherlich generell wirklich groteske Orte. Egal auf welchem Festival man auch ist, der Zeltplatz ist stets ein Ort, der nichts mit einer normalen Lebensrealität zu tun hat. Bevor wir also diese Parallel-Parallelwelt erkunden, statten wir uns im Festival-Penny am Eingang des Festivalgeländes aus. Selbstredend ist das Sortiment passgenau auf die Bedürfnisse der Festivalbesucher:innen ausgerichte. Es gibt also neben einem riesigen Angebot von Alkohol auch entsprechende Kontermittel wie Katerfly und ein 2-mal-5-Meter-Regal voller kalter Kaffeespezialitäten in den Varianten Espresso (rot), Latte (gelb) und Cappuccino (blau). Ihr braucht kein Katerfly; die eiskalte Mischung aus Koffein und Zucker reicht vollkommen aus, um euch nach einer viel zu langen Nacht wieder vollständig ins Leben zu schießen.
Der Penny wird heute des Öfteren noch zu unserem Sehnsuchtsort werden. Passend zum Penny-Einkaufserlebnis gibt es gleich nebenan die Penny-Stage, vor der gegen 15 Uhr vereinzelt Festivalbesucher tanzen. Ungefähr fünf Männer liegen derweil in einem aufblasbaren Einhorn in der ersten Reihe der Crowd. Ein anderer spielt am Ende der Holzplatte, auf denen Penny-Markt und -Stage stehen, Minigolf, wobei ein Red Cup Becher als sein Minigolf-Loch und ein tatsächlicher Minigolf-Schläger als sein Minigolf-Schläger fungiert. Der mitgebrachte Minigolf-Schläger verdeutlicht: Diese Idee muss ihn schon lange begleiten. Er trifft im zweiten Versuch in ein ca. 15 Meter entferntes Loch – Birdie. Wir freuen uns am Red-Cup-Loch gemeinsam mit seinem Caddie.
Parookaville ist eine Stadt – und sie ist versorgungstechnisch besser ausgestattet als die meisten deutschen Orte (sie ist mit ihren ca. 225.000 „Einwohner:innen” auch die 35. größte Stadt Deutschlands – größer als Oberhausen). Direkt neben dem Penny gibt es sogar einen Hagebaumarkt. Auch wenn der Baumarkt-Besuch an einem Samstag für den deutschen MANN eigentlich obligatorisch ist, sparen wir uns diesen Ausflug. Da eh keine Bundesliga stattfindet, wäre der MANN-Samstag trotz Baumarkt-Besuch auch nicht komplett.
Dass in Deutschland gerade Fußball-Sommerpause herrscht, merkt man auf dem Campingplatz nicht. Das Kleidungsstück Nummer 1 der Männer ist eindeutig das Fußballtrikot. Das Ruhrgebiet ist gut vertreten, die meisten Besucher scheinen Anhänger des FC Schalke zu sein. Auch der DJ Mogui legte am Freitag bereits im blau-weißen Trikot auf. Duisburg Fans sehen wir auch häufiger, von Borussia Dortmund fehlt jede Spur. Einzig allein die häufig zu hörenden Schmähgesänge „Ade ade ade ade ade oh, BVB H****sö***“ erinnern an den Fast-Meister. Der „Look der Saison” ist aber definitiv das Fußballtrikot der eigenen Lokalmannschaft. Egal ob TS Rahm oder SG Telgte – würde man alle Anwesenden mit dieser Bekleidung in Fußballteams einteilen, könnte man vermutlich den kompletten Spielbetrieb des Verbands Westfalen von der Kreisliga C bis zur Oberliga sicherstellen.
Häufiger als Fußballtrikots sieht man maximal Bier-Bongs und noch mehr Bier-Pong-Tische. Mein Gott, waren das grotesk viele Bier-Pong-Tische. Wie viele Minuten auf dem Festival vergangen sein müssen, in denen Personen verzweifelt probiert haben, den letzten Bier-Pong-Becher zu treffen? Musikalisch scheint sich der Zeltplatz in zwei Lager zu spalten. Auf der einen Seite gibt es die Malle-Schlager-Bier-Bong- und auf der anderen die Wir-sitzen-zu-180BPM-Gabber-ruhig-im-Kreis-Fraktion, die sich verteilungstechnisch ungefähr die Waage halten.
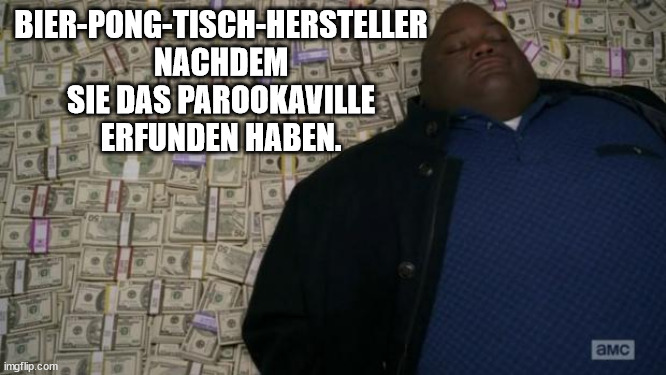
Im Marketing-Himmel
Nach dieser kurzen Safari über den Campingplatz (ebenfalls grotesk groß) geht es zurück auf das Festivalgelände. Schließlich wollen wir noch allerhand Unternehmens-Marketing-Aktivitäten ausprobieren. Wir beginnen mit Dosenwerfen auf Gorbatschow-Dosen am Gorbatschow-Stand, bei der wir Gorbatschow-Socken (Hauptpreis) und einen kleinen Plastikbecher mit 0,1 Liter Wodka-Lemon (Gorbatschow) (Trostpreis) gewinnen. Dann geht’s zum andächtigsten, ja, man könnte sagen, zum gottesfürchtigsten Teil unseres Tages: diversen (inoffiziellen) Hochzeiten in der Warsteiner-Kirche.
Als wir uns in das hölzerne Haus des Festivalgottes – die alten Griechen nannten ihn Dionysus, heute besser bekannt als Alkohol – durch Vorlage unseres Presseausweises an der Warteschlange vorbeischleichen, bietet sich uns ein Anblick, der bei den meisten katholischen Gemeindevorstehern für Neid und gleichzeitig Abscheu sorgen würde. Vier vollbesetzte Bankreihen flankieren einen Mittelgang, der zum Altar führt: eine mit Pampasgras verzierte Holzkonstruktion, die sich so auch in einer beigen Insta-Influencer:innen-Wohnung sehen lassen könnte.
Hinter dem Altar steht eine junge Frau in schwarzem, ärmellosen Top und weißer, mit dem Warsteiner-Logo versehener Stola, die zu viel zu lautem Techno gerade ein glückliches Paar vermählt. Er in knielanger Jeans, Poloshirt und schwarzem Zylinder, sie in Blümchenkleid und weißem Schleier. Doch wird der Blick sofort vom Herzstück dieses Tempels gefangen. „DAS EINZIG WAHRE – SEIT 1753 – WARSTEINER” schreit es uns vom blumengeschmückten, circa 2,5 Meter großem Warsteiner-Logo entgegen, das wie Jesus am Kreuze hinter der Bier-Priesterin aufragt. Die Predigt der Priesterin verläuft dabei stets passgenau auf dem Klangteppich der Technobeats – Amen!
Unserer Rolle als stille Beobachter folgend wohnen wir einigen Trauungen bei, die stets fast exakt nach christlichem Vorbild ablaufen. Hier ein exemplarischer Ablauf: Das glückliche Paar tritt vor die Priesterin. Zu ihm sagt sie einen Satz à la: „Willst du deine Auserwählte lieben, auf dass dein Herz immer im Takt des Techno schlagen wird, wenn du sie siehst?“ „Ja, ich will.“ Und zu ihr gewandt eine Frage im Stil von: „Willst du deinem Mann beistehen, in guten wie in schlechten Zeiten und ihm immer ein kaltes Warsteiner anbieten, wenn er Durst hat?“ „Ja, ich will.“ „Hiermit erkläre ich euch, im Namen von Parookaville, zu Mann und Frau. Du darfst die Braut jetzt küssen.“
Mal küssen sich die Frischvermählten, mal umarmen sie sich – je nach tatsächlichem Freundschafts-/Beziehungsstatus. Und dann zum krönenden Abschluss gibt es noch Foto mit der festinstallierten Kirchenkamera, den das Paar als Abzug mitnehmen darf, der aber auch auf einem lebensgroßem Bildschirm an der äußeren Kirchenfassade abgebildet wird. Hallelujah!
Es kam, wie es kommen musste: „Er kam nicht“
Von dieser übersinnlichen Episode, nun ja, beseelt, schlagen wir den Weg zurück zum Pressezelt ein. Unsere Aufregung wächst, erfüllt sich doch in wenigen Minuten der Anlass unseres Parookaville-Besuchs. Endlich ist das Gespräch mit Da Hool, dem Pionier des Ruhrpott-Technos, zum Greifen nahe. Wie vereinbart, betreten wir eine Viertelstunde vor Interviewbeginn den Presse- und Artistbereich, der vom McDonalds-Foodtruck im Artist-VIP-Bereich konstant in eine Wolke des Burger- und Fritteusendufts gehüllt ist und hocken uns in Erwartung großer Erkenntnisse ins Pressezelt.
Zehn Minuten noch. Wir gehen noch einmal unsere Fragen durch: Wie hat ihn das Ruhrgebiet in seinem Schaffen geprägt? Welche Entwicklungen in der Szene hat er seit den Neunzigern erlebt? Was hält er von der fortschreitenden Kommerzialisierung? Welche Acts guckt er sich auf dem Parookaville selber an?
Fünf Minuten noch. „Haha, wetten er kommt gleich einfach zehn Minuten zu spät.” „Ja, oder halt gar nicht.” So scherzen wir, um unsere Aufregung zu überspielen. Die Minuten vergehen quälend langsam.
Es ist Zeit. Im Sekundentakt schwenkt der Blick zwischen Artistzelt-Ausgang, Pressezelt-Eingang und Handy-Uhr.
Nach knapp fünf Minuten kommt nicht Da Hool, sondern eine junge Frau mit Klemmbrett ins Zelt gehuscht. Sie unterhält sich kurz mit den Parooka-Presse-Beauftragten und folgt dann deren Fingerzeig an unseren Tisch. Nach einer gegenseitigen Vorstellung vertröstet sie uns. Sie wisse nicht, wo Da Hool sei, im Artistbereich war er nicht aufzufinden, sie schicke ihn zu uns, sobald sie ihn sehe. Für uns beginnt nun eine zunehmend nervige halbe Stunde, in der wir auf den DJ warten, bis die Chance, dass wir vor seinem Auftritt noch genug Zeit für das Interview haben, gen Null geht. Von dieser Wartezeit frustriert, ja, von unserem kurzzeitigem Idol enttäuscht, geben wir die Hoffnung nach fast einer Stunde Wartezeit auf und ziehen zu unserer Wohlfühloase: dem Penny-Markt. Vielleicht ist der Minigolf-Held ja noch da.
Der durch sein Sortiment und ferner seine Preise ungemein beseelende Penny bereitet uns nach diesem Frusterlebnis wieder einigermaßen gute Laune. Naja, denken wir uns, Da Hool ist ja schon ein großer Artist, der sicherlich viel um die Ohren hat. Ist ja auch immer wie Klassentreffen so ein Festival, man muss dem und dem erzählen, was man so den lieben langen Tag macht. Bestimmt hat er sich einfach verquatscht. Wir akzeptieren unser Schicksal und gehen trotzdem erwartungsvoll zu seinem Auftritt an der Time Lab Stage. Zeitmaschine deshalb, da hier vor allem (aber nicht nur) gestandene Artists ihre Songs aus der Vergangenheit in die Gegenwart teleportieren dürfen. So katapultiere Darude seinen memegewordenen „What’s this song?”-Klassiker „Sandstorm” oder The Disco Boys den BVB-Stadion-Einlauf Song „For you” auf der Time Lab Stage in die Jetztzeit.
Also erhofften wir uns auch von Da Hool seine 90’s Classics wie „B.O.T.T.R.O.P.” oder natürlich „Meet her at the Loveparade”, der vielleicht als der berühmteste Techno-Song aus dem Ruhrgebiet gelten kann. Bezüglich „B.O.T.T.R.O.P.” fielen unsere Hoffnungen geringer aus, schließlich ist der Track sicherlich weit von dem entfernt, was heute so in den Clubs und auf den Stages gespielt wird. Aber auch bei „Meet her at the Loveparade” war es wie mit Da Hool bei unserem Interviewtermin: Er kam nicht.
Aber damit war noch lange nicht das Ende der Enttäuschungen erreicht. „Verschüttete Träume, Bilder aus alten Tagen”, sang eine Männerstimme über eine drumtechnisch recht leise Stelle. Moment mal, bei dem Text klingelt doch was: „Vom Wahnsinn, den ich lebte, und was sie mir heute sagen, ich schlief zu wenig.” Wir warfen uns einen Blick zu, in dem sich pures Entsetzen und morbide Freude über die Absurdität der Situation mischten, bevor gute 70 % des Publikums „Und ich trank zuviel” mitgröhlten und der Bass einsetzte. Als wäre dieser Mix von „Gute Freunde” der Böhsen Onkelz noch nicht deranged genug, ging Da Hool im Anschluss nahtlos in „Zombie” von den Cranberries über, um dieses Trio Infernale mit David Guettas „Work Hard Play Hard” abzurunden.
Nach einigen nicht erinnerungswürdigen Tracks, bei denen Da Hools Konzept-Atze – ein Atze mit festem Platz im Auftrittskonzept, dessen einzige Aufgabe darin besteht, in Kirmesanheizer-Manier das Publikum zu Moshpits und ähnlichem aufzufordern – noch einmal versuchte, alles aus der Menge herauszuholen, schloss Da Hool sein Set mit einem Remix von Nirvanas Smells Like Teen Spirit ab. Die Zeitmaschine hat also funktioniert und die 90er zurückgebracht. Jedoch in grotesker Zerrgestalt.
Über den Tag verteilt haben wir, was die Musik betrifft, eine kleine These entwickelt: Jeder Song, der zumindest einmal in den deutschen Top 20 war, wurde heute als Elektro-Mix auf dem Parookaville gespielt. Egal ob „Country Roads“, „In the End“ oder „Wildberry Lillet“. Wichtig war nur, dass der Mix nie länger als 30, vielleicht in Ausnahmen mal 60 Sekunden war, da sonst aufgefallen wäre, wie langweilig und generisch jeder einzelne dieser Tracks in Wahrheit ist.

Was würde Manny Marc tun?
Zufrieden waren wir nach dem Auftritt keinesfalls – innere Leere. Erst kein Interview, dann kein „B.O.T.T.R.O.P.“ und auch nicht den bekanntesten Techno-Song aus dem Ruhrgebiet.
Etwas frustriert standen wir im Meer freudig lachender Menschen. Wir hörten die glücklichen Menschen uns in Gedanken ausbuhen und fragten uns entsprechend: Was würde Manny Marc tun?
Ein Glück, dass Manny Marc höchst selbst uns diese Frage beantworten konnte. Ja genau, die Atzen hatten auch einen Slot auf dem Parookaville. Auf der Brainwash-Stage, auf der auch einige Nicht-Elektro-Acts wie Cat Ballou, Mia Julia, Eko Fresh oder eben die Atzen Stagetime bekamen. Also nahm er uns mit in die Rummelbums-Disko und alles war vergessen.
Ordentlich STROBO-Pop bekamen wir dann nicht nur von Manny Marc und Frauenarzt; die hatten Verstärkung mitgebracht. Auf der Bühne standen ebenfalls Twitch-Glücksspiel-Ikone und ProSieben-Dauergast Knossi, der seinen Welthit „Alge” zum besten gab, so wie Evil Jared (gebürtig Jared Hasselhoff), seines Zeichens ebenfalls ProSieben-Dauergast und Ex-Mitglied der Bloodhound Gang. Der Amerikaner ist jedoch nicht extra angereist, um ein bisschen Disco Pogo auf der Bühne zu betreiben. Nein, er trat auch selbst auf der Brainwash-Stage auf und war zudem Trauzeuge bei der einzigen Hochzeit, die tatsächlich rechtsgültig auf dem Parookaville geschlossen wurde! Wir wissen nicht, ob wir es nochmal wiederholen müssen, aber: grotesk!
Wozu wir also auf dem Parookaville waren? Wenn schon nicht, um ein Interview zu führen, Amateur-Fußballtrikots zu bestaunen, in der Warsteiner-Kirche zu Gott zu finden oder „Country Roads“ auf 160 BPM zu hören, dann doch zumindest, um mit den Atzen, Knossi, Evil Jared und 225.000 anderen „Hey das geht ab” zu brüllen und den letzten Funken geistiger Unversehrtheit auf dem City of Dreams Gelände zu lassen.
Bock auf mehr STROBO? Lest hier: Über Umwege im Lebenslauf – der Künstler Null:ae im Porträt