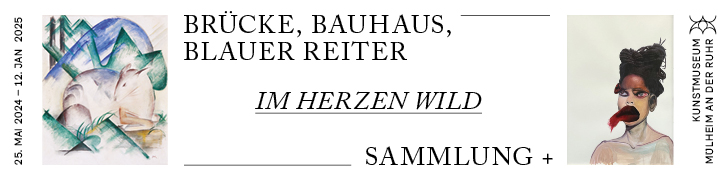STROBO-Redakteur Tobi hat gemischte Gefühle zum kommenden ESC. Sein Fazit nach zwei Stunden und 39 Teilnahmeländern: Neben dem geilen schrägen Zeugs gibt es auch verdammt viele langweilige Songs. Wieso, lest ihr bei STROBO:Insights.
Der Eurovision Song Contest (ESC) ist ein abgekapseltes musikalisches Paradies. Eine weirde, verrückte Welt, die mit meinem eigentlichen Musikgeschmack relativ wenig zu tun hat (außer ich schmettere betrunken „Rise Like a Phoenix“ von Conchita Wurst). Zugegeben, der ESC hat auch relativ wenig mit dem Ruhrgebiet zu tun – bis auf das eine Mal, als ein Bochumer, der auf die gleiche Grundschule wie ich gegangen ist, für Lettland angetreten ist, kein Witz.
Dieses Wochenende öffnen sich erneut die Pforten des Paradieses in der Rotterdamer „Ahoy-Arena“ und ich weiß schon jetzt, dass ich ein Wochenende lang dem ESC-Fieber verfallen muss. Geht es euch genauso, solltet ihr so langsam alle Schmerzmittel zusammen kramen und die Waschlappen kalt legen, denn ich kann euch versprechen, dieser ESC wird wild.

Woher ich das weiß? Ich habe mir nur für euch (und auch ein bisschen aus fehlender Selbstachtung) alle Lieder der 39 fucking Teilnahmeländer angehört. Das sind zwei Stunden, die ich nie wieder bekomme.
Immer dieselbe Laier
Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die viel zu hohe Dichte an Powerballaden. Seitdem der ESC im letzten Jahr flach gefallen ist, hat sich wohl so viel Energie in den Kehlen der Sänger:innen angestaut, dass sie gar nicht anders können als irgendwelche schnulzigen, immer gleich klingenden Songs zu fabrizieren, die nur durch Tonartwechsel noch künstlich am Leben gehalten werden können. Nur weil du einen Ton länger als zwei Takte halten kannst, mutierst du nicht gleich zu Adele, verdammt!
Dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl an Songs, denen ich den Stempel der überdrehten und gleichzeitig unglaublich langweiligen Partymusik aufdrücken will. Würde man einer schlecht programmierten KI das „worst of David Guetta“ füttern, wären die Ergebnisse vermutlich immer noch kreativer als das, was bei manchen ESC-Künstler:innen so rumkommt (hust Tschechien, hust Moldawien).
Feminismus und “König der Löwen”
Doch neben den objektiv (lol, hier ist nix mehr objektiv) schlechten Acts gibt es auch ein paar, die mir echt gut gefallen. Finnland und Italien liefern solide Rocksongs ab, die Französin Barbara Pravi einen gefühlvollen Chanson, die Vertreterin von Russland feministischen Rap. Ja, richtig gelesen. Sowieso gibt es in diesem Jahr viele Songs mit politischer Botschaft (auch wenn das laut ESC-Komitee ja eigentlich verboten ist, upsi). Und dann gibt es noch Nord-Mazedonien, dessen Beitrag so klingt, als ob er eins zu eins aus „König der Löwen“ kommen könnte. Ernsthaft, die volle Musical-Dröhnung.
Doch bevor ich zu den drei wildesten Songs des diesjährigen ESCs komme, eine kurze Definition was ich damit eigentlich meine: Alles was schräg, schrill, überraschend, lustig, oder schockierend ist, ist wild. Muss ich während der Performance lachen, vor Scham weinen oder finde ich einfach keine Worte mehr, befinden wir uns in der ESC-Wildnis. Also anschnallen, festhalten, wir gehen auf Safari.
Platz 3:
der wildesten ESC-Beiträge dieses Jahr belegt der isländische Künstler Daði Freyr zusammen mit seiner Gruppe Gagnamagnið. Viel Spaß beim Aussprechen. Der Song, mit dem sie 2020 angetreten wären und auch safe gewonnen hätten, läuft übrigens seit ein paar Monaten auch im deutschen Radio und ist sowieso ein Welthit. Der diesjährige Beitrag „10 Years“ ist mein Lieblingssong beim ESC, weil man mich mit Disco viel zu einfach überzeugen kann. Aber jetzt mal ehrlich. Wie geil ist es bitte, sich mit Pyjamas, auf denen das eigene verpixelte Gesicht vorne draufgeklatscht ist, auf eine Bühne zu stellen, und dann in Tik-Tok Manier synchron zu tanzen? Und das Solo von diesen Keytar/Synthesizer/Feuerwerk-Pappboxen bitte erst. Wild.
Platz 2:
der wildesten ESC-Beiträge dieses Jahr belegt die ukrainische Gruppe “Go_A” mit ihrem Song „Shum“. Übersetzt heißt das „Lärm“ und ich kann mir vorstellen, dass da einige auch keinen Unterschied erkennen. „Shum“ ist anders als alle anderen Songs, vermischt Elemente von ukrainischer Volksmusik und Electro. Zwischendurch meine ich auch eine Maultrommel rauszuhören. Wilde Kombi, aber ballert. Das Musikvideo ist nicht weniger schräg. Erst fährt die Frontsängerin Kateryna Pawlenko auf einem Mad-Max ähnlichem Gefährt durch den Schnee, dann finden sie im Wald genug Equipment, um am Ende einen Lagerfeuer-Rave in der Nähe von Tschernobyl zu veranstalten. Und wie wild ist bitte dieser Gesichtsschmuck?
Platz 1:
und das tut mir jetzt mindestens genauso weh wie euch, goes to: Dschörmenie. Eines kann man dem deutschen Act dieses Jahr wirklich nicht vorwerfen: Dass er langweilig ist. Jendrik heißt unsere Konfettikanone, „I Don´t Feel Hate“ sein Song. Die Message finde ich gut, deutsche ESC-Lieder über „ein bisschen Frieden“ haben ja sowieso Tradition. Warum also nicht auch angepasst auf 2021?
Musikalisch hat Jendrik mit Nicole jedoch wenig am Hut. In „I Don´t Feel Hate“ passiert einmal alles, von Ukulelen-Kindersong zu Electro-Blaskappelle zu Stepptanz-Einlage und wieder zurück. Ein bisschen viel, aber genau die richtige Dosis um mich am Ende sprachlos zurückzulassen – also ziemlich wild. Das Musikvideo ist eine Erfahrung für sich, die ich keinem nehmen möchte. Nur soviel vorweg: Das große Kostüm soll einen Mittelfinger darstellen und keinen Penis. Glaube ich.
Ich gebe dem Eurovision Song Contest 2021 insgesamt fünf von sieben wilden Punkten™. Für die volle Punktzahl nächstes Jahr bitte mehr hiervon und weniger Powerballaden, danke.
Bock auf mehr STROBO? Lest hier: Warum Live-Alben mich durch die Pandemie retten