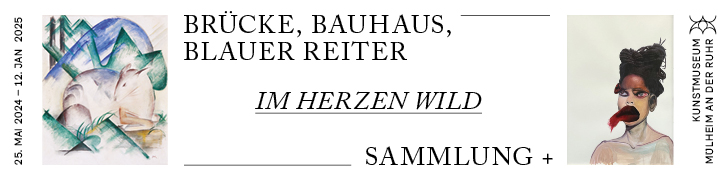Früher fand STROBO-Redakteurin Leonie sie mehr als unnötig, heute geht es für sie nicht mehr ohne: In der dritten Ausgabe von STROBO:Insights verrät euch Leonie, wieso sie nach über einem Jahr Pandemie zum Fan von Live-Alben geworden ist.
Der Tag war anstrengend, ich sehe seit Monaten den immergleichen Laptop, auf dem gleichen Tisch mit der fast immer identischen Tasse Tee neben mir. Ich dürste nach Abwechslung. Vor ein paar Wochen habe ich mit einer Bewältigungsstrategie angefangen, um mich aus dieser ermüdenden Misere zu befreien: Ich höre jetzt auch Live-Alben.
Live-Alben? Also mitgeschnittene Konzerte, auf denen die Atmo manchmal lauter ist als der richtige Ton? Jap, genau – Live-Alben halt. Früher habe ich sie gehasst, weil: „die Studio-Version ist eben einfach sauberer und wenn ich Live-Musik hören will, gehe ich auf ein Konzert.“ Fast so schlimm wie Best-Of Alben, weil: „sowas hören ja eh nur die, die keine Ahnung haben“ (Sorry für den Snobismus an dieser Stelle). Jetzt aber, 407 Tage nach Beginn des ersten Lockdowns und einem verlorenen Festival-Sommer, sieht die Lage anders aus.
Und dann bin ich eben in Hamburg, Berlin, Dresden oder was auch einer Stadt, in der mir von den Musiker:innen und Bands entgegengeschrien wird. Ist zwar gelogen – aber egal.
Das Wetter ist scheiße, mir ist kalt und ich will endlich Sommer haben: Ich verbinde mein Handy mit meiner orangefarbenen Bluetooth-Box und höre lautstark Seeeds Album „Live“ von 2006. Mir ist nach Feiern zu Mute: einige Tracks auf Caspers Live-Album „Der Druck steigt“ von 2012 ballern richtig. Und wenn gar nichts geht: Es gibt immer irgendeinen guten Konzertmitschnitt von Arte, den ich im Hintergrund laufen lassen kann. Wirklich. Immer.

STROBO-Redakteurin Leonie auf dem Juicy Beats 2019. Damals fand sie Live-Alben noch scheiße, da gab’s Live-Musik aber auch noch (und fancy Aufkleb-Tattoos). Foto: Privat.
Und dann bin ich eben in Hamburg, Berlin, Dresden oder was auch immer einer Stadt, in der mir von den Musiker:innen und Bands entgegengeschrien wird. Ist zwar gelogen – aber egal. Hauptsache gedanklich raus, Hauptsache Konzertatmosphäre fühlen.
Mit Live-Alben gegen die Konzert-Dürre
Mein letztes richtiges Konzert war im November 2019 – vor fast eineinhalb Jahren. Das ist ein Zeitraum in dem Menschen schwanger werden, ein Baby kriegen, und dann wieder mitten in der nächsten Schwangerschaft sein können.
Und damals, im November 2019 vor der Dortmunder Westfalenhalle, hatte ich noch nicht einmal besonders viel Lust. Ich hatte Karten für Seeed – Demba Nabé war schon über ein Jahr tot und ich deshalb – und wegen Uni-Stress – schlecht drauf und übermüdet. Hätte ich gewusst, wie ausgedörrt ich heute sein würde – ich wäre mit definitiv mehr Energie an diese ganze Konzert-Sache herangegangen. Aber wie es immer so ist: Man weiß erst, was man an Dingen hat, wenn sie nicht mehr da sind. Oder wenn ein weltweites Virus plötzlich auftaucht und allem einen gewaltigen Strich durch die Rechnung macht – danke dafür.
Das Seeed-Konzert war dann letztendlich trotzdem schön und ist in meine Sammlung von Erinnerungen gewandert, von denen ich jetzt in Zeiten der absoluten Konzert- und Festival-Dürre zehre. Und die mir Live-Alben wieder hervorholen – gerade wegen der lauten Atmo.
Die Sache ist: Ich kann es kaum erwarten, wieder Live-Musik zu hören – und zwar wirklich live.
Darunter: Mein erstes Festival mit meinem Vater mit zwölf Jahren – acht Stunden ohne Essen auf einer Stelle stehen, um Thirty Seconds to Mars von der besten Position aus zu sehen. Jahre später dann auch mein Vater, der mit mir bei Trailerpark steht und die Texte mit „okay“ kommentiert. X-Marker auf den Handrücken, die ich mir mit einer Freundin auf der Toilette massiv abschrubbe, damit wir noch zur Aftershowparty bleiben können – dann wie wir uns zehn Minuten auf dem Klo verstecken, weil wir Paranoia schieben, dass man uns erwischen könnte.
Vom „Pocahontas“-Mitschreien
Abgerissene Plakate von Herrentoiletten unter dem strengen Blick der Security-Frau im Eingangsbereich unter dem Hoodie herausschmuggeln, weil das Turbostaat-Tour-Plakat mit dem Schwan so unglaublich cool aussieht. Der Biffy Clyro-Drumstick, den die Frau neben mir gefangen hat (knapp verfehlt) – und der Editors-Drumstick, den ich dann gefangen habe. Gequetscht werden bei Deichkind in der ersten Reihe und das erste Mal aus der Menge rausgezogen werden. Super heiser sein nach Annenmaykantereit, weil man „Pocahontas“ einfach so verdammt gut mitschreien kann.
Die Sache ist: Ich kann es kaum erwarten, wieder Live-Musik zu hören – und zwar wirklich live. Mit einer richtigen Band auf der Bühne, unbekannten Menschen hinter, vor und neben mir und dem beißenden Geruch von Bier in der Luft, den man auch am nächsten Tag nicht aus den Klamotten bekommt. Weil das Gesamtpaket einfach viel mehr transportiert als es Studio-Alben können. Weil es sich bei Live-Musik um die Momente vor, auf und nach dem Konzert dreht. Und bis das nicht wieder möglich ist, setze ich mir meine Kopfhörer auf, mache das „Der Druck steigt“ Casper an, drehe laut und wünschte, ich wäre da.
Bock auf mehr STROBO? Lest hier: Warum ich keinen Bock auf Zoom-Interviews habe