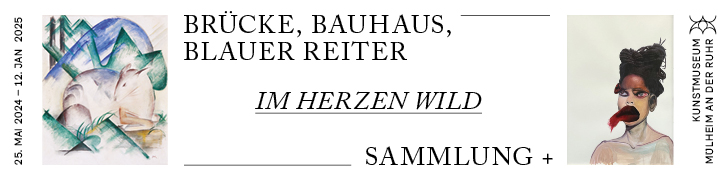Es gilt als ungeschriebenes Gesetz, dass Liebesbeziehungen spätestens mit dem Ende der Ausbildungszeit zu einem wichtigen Lebensbestandteil werden. Was das mit heteronormativen Ideologien zu tun hat und warum es wichtig ist, Freund:innenschaften im Laufe des Lebens nicht zu Nebenschauplätzen verkommen zu lassen, schreibt Lena Spickermann in ihrer aktuellen Kolumne.
Wer kennt es nicht? Der:die eine Freund:in, mit dem:der man Nächte lang am WG-Küchentisch gesessen hat, bei Rotwein und einem besorgniserregenden Ausmaß an Zigaretten über die sozialen Schieflagen dieser Welt diskutiert, mit dem:der man auf Festivals bis zum Morgengrauen durchgetanzt hat oder der:die einen schlichtweg mit Umarmungen und aufmunternden Worten versorgt hat, als sich das Leben einfach mal wieder so unglaublich schwer angefühlt hat. Plötzlich ist er:sie nicht mehr da – er:sie ist in einer neuen Liebesbeziehung. Und obwohl das erst einmal Grund zur (Mit-)Freude wäre, kann man sich der eigenen darauffolgenden Enttäuschung manchmal nicht erwehren.
Denn plötzlich verändert sich etwas. Die Treffen werden seltener, der Gesprächsstoff kreist sich immer mehr um den:die neue:n Partner:in, seinen:ihren Style, seinen:ihren Intellekt, seine:ihre Interessen, politischen Überzeugungen und das gemeinsame Leben als Paar. Nun können sich viele wahrscheinlich mit beiden Seiten identifizieren. In diesen Fällen stellt sich die Frage, ob Freund:innenschaften zwangsläufig nur Zwischenstationen bzw. Beiwerk von (heterosexuellen) Liebesbeziehungen sein müssen. Muss man sich auf kurz oder lang einfach damit abfinden?
Freund:innenschaften als Beziehungen mit Ablaufdatum?
Grund für diese Dynamik, die lange unhinterfragt zu bleiben schien und als natürliche Resultat einander ablösender Lebensabschnitte gilt, ist eine Folge unserer heteronormativ und (guess what) kapitalistisch strukturierten Gesellschaft. Ein je nach Klassenlage und Sozialisation (Stichwort: Privilegien) variierender, idealtypischer Lebensentwurf lautet so: Nach der Schulzeit folgt eine Phase des Erkundens, Experimentierens und der Spontanität. Die Suche nach neuen Erlebnissen, Orten, neuen Verbindungen, Lebensinhalten, Idealen usw. steht im Vordergrund. Die Offenheit, die man währenddessen an den Tag legt, ergibt sich durch den Luxus, noch nicht festgelegt sein zu müssen.
Diejenigen, die studieren, wollen und können sich meist noch nicht vorstellen, wie es danach weitergeht, welche berufliche Realität ihnen bevorsteht. Und auch partner:innenschaftlich ergeben sich meist noch keine unerschütterlichen Liebesbeziehungen. Das führt dazu, dass wir gerade in dieser Phase intensive Freund:innenschaften führen, die unseren Alltag strukturieren und das Zentrum unseres sozialen Lebens bilden. Time- und Self-Management, Work-Life-Balance, Kapazitäten und Kalenderwochen sind noch leere Begriffe, die keine wesentliche Bedeutung haben.
Dann aber folgt häufig eine Phase, die gerade in (heteronormativen) Frauen-Freundinnenschaften zur Herausforderung wird: Waren Männer durchaus zuvor schon Gesprächsanlass und können sich wohl nur wenige davon freisprechen, nächtelang über emotional unreife Dating-Partner fabuliert zu haben, werden diese Männer nun zu festen Bestandteilen der Freundinnenkonstellation; auch wenn sie sich nicht am selben Ort befinden.
Die beste Freundin als „Flirt- und Krisenhilfe“ – Bini Adamczak
In ihrem Essay „Freundinnen werden“ erfasst Bini Adamczak in dieser Dynamik ein Machtgefälle: Die Freundin ist nun nicht mehr eine ebenbürtige Beziehungspartnerin, sondern wird zur „Flirt- und Krisenhilfe“. In das Zentrum der Freund:innenschaft werden nun nicht mehr die eigenen Interessen, Leidenschaften, Wünsche und Ängste hineingebracht, die man gemeinsam teilt und als für sich stehende Person einbringt. Eher werden nun die Liebesbeziehungen zu einer dritten Instanz in den Gesprächsfokus gerückt. Die Relevanz freundschaftlicher Nähe, die ein hohes Identifikationspotenzial geboten hat, verliert langsam an Bedeutung – es ist nun eher der (Liebes-)Partner, dem man sich an erster Stelle verpflichtet fühlt.
Die Geschichte einer westlichen Bilderbuchbiografie lässt sich an dieser Stelle abkürzen. Womöglich kann sich ein:e jede:r vorstellen, was darauffolgt: Das Studium oder die Ausbildung kommt zu einem Ende, Umzüge stehen bevor, Hochzeiten werden gefeiert, Kinder kommen zur Welt, Terminkalender füllen sich, familiäre und berufliche Verpflichtungen häufen sich und digitale Kommunikation tritt an die Stelle physischer Treffen, die dann nur noch gelegentlich stattfinden.
Heterosexuelle Liebesbeziehungen als alternativloses Lebensmodell?
Nun sollte der:die einzelne für diese Entwicklung erstmal nicht verurteilt werden. Die Ideologie der romantischen Heterobeziehung spukt immer noch als erstrebenswertes Happy-End in unseren Köpfen und auch das Konzept der bürgerlichen Kleinfamilie hat noch nicht ausgedient. Ideologien weisen leider eine hohe Widerstandsfähigkeit auf. Hinzu kommt, dass diese Modelle nach wie vor für eine kapitalistisch strukturierte Gesellschaft von Vorteil sind und deswegen auch besonders gefördert werden (wo ein Elternteil – meist die Frau – zu Hause bleibt oder nur in Teilzeit arbeitet, können z. B. die Kosten für öffentliche Infrastruktur geringgehalten werden). Alternative Beziehungsmodelle ohne romantische Konnotation, in denen ebenfalls gegenseitige Care-Verpflichtungen übernommen werden, haben hierzulande keine große Lobby. Wenngleich politische Modelle in der Diskussion sind, die auch Freund:innen die Gelegenheit geben sollen, (rechtliche) Verantwortung füreinander zu übernehmen (Stichwort: Verantwortungsgemeinschaften).
Gegen eine neoliberale Ideologie unabhängiger Subjekte
Aber wieso ist es nun überhaupt wichtig, dass ich neben meinem:meiner Partner:in noch andere Verbindungen pflege und sie nicht zu Nebenschauplätzen verkommen lasse? Seit ich nicht mehr Studentin bin, also eine neue Phase meines Lebens angebrochen habe, wird diese Frage plötzlich sehr relevant. Mit den steigenden Verpflichtungen sind enge Freund:innenschaften plötzlich keine Selbstläufer mehr. Man muss sich bewusst für sie entscheiden. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich mit der gesellschaftlich zurechtgelegten Antwort nicht zufrieden geben möchte.
Es sind vor allem queere Menschen, die auf eine breit gespannte, freundschaftliche Community angewiesen waren (und immer noch sind) und diese zu einem wesentlichen Lebensbestandteil gemacht haben. Der Zusammenhalt, der sich dadurch ergibt, resultiert aus der erfahrenen gesellschaftlichen Diskriminierung, die den Bezug zu einer sogenannten chosen family essentiell machen. Wir sollten aufhören, diese Konstellationen als abwegige Ausnahmefälle zu betrachten und Menschen, die ihre Freund:innenschaften zentrieren, als „unreif“ und „ewig jung geblieben“ ins Lächerliche zu ziehen.
Auch wenn ich selbst nicht von solchen systemischen Zwängen betroffen bin, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass eine einseitige Konzentration auf Familie und Liebesbeziehung nicht nur wegen fortbestehender Geschlechterstereotype nichts für mich ist (Stichwort: geschlechtsspezifische Care-Beziehungen, Altersarmut bei Frauen, mental load etc.). Freund:innenschaften zu zentrieren heißt auch, gegen eine neoliberale Ideologie vorzugehen, die an die Stelle sozialer (Care-)Communities, das unabhängige Individuum setzt. Sie lässt soziale Kontakte zu einem lästigen To-Do oder gar zu einem selbstoptimierenden Networking-Event verkommen. Die Entscheidung dagegen kann ermächtigend sein und als politischer Akt des Widerstands erfahren werden! Die Autorin Zadie Smith spricht dazu passend auch von einer Care-Taking-Revolution.
Mehr Verantwortung neben unseren Liebesbeziehungen
Es gilt mittlerweile als No-Brainer, dass partnerschaftliche Beziehungen keine Selbstläufer sind, also viel Zeit, Arbeit und Engagement mit sich bringen. Warum tragen wir dieses Gewissen zur Abwechslung nicht auch mal an Freund:innenschaften heran? Klar, das klappt nicht immer – Idealismus verträgt sich nicht immer mit dem Alltag. Nehmen wir unsere Beziehungen zu unseren Freund:innen genauso ernst wie die zu unseren Partner:innen, bedeutet das auch, Konflikte auszutragen, Unannehmlichkeiten anzusprechen, Kritik auszuhalten, zu lernen, möglichst klar zu kommunizieren und auch Verpflichtungen einzugehen.
Ich selbst scheitere regelmäßig daran und mit jeder neuen Lebenssituation (aufgrund von Umzügen, neuen Jobs, Kindern etc.) ergeben sich neue Herausforderungen, die ihre Erfüllung erschweren. Es kann und soll sicherlich nicht darum gehen, allen Bezugspersonen stets dieselbe Aufmerksamkeit zu schenken. Es geht hier auch nicht um die Summe der Verabredungen und Gespräche, die wir miteinander führen, sondern um die Perspektive, die wir auf eine freundschaftliche Beziehung haben und auch die Bedeutung, die wir ihr beimessen.
Wenn ihr euch das nächste Mal neu verliebt, heißt das nicht, dass ihr die gemeinsame Zeit mit eurer neuen Beziehungsperson extra auf einem geringen Level halten musst, um weiterhin eine gute Freundin zu sein. Es geht vielmehr darum, in Verbindung zu bleiben, klarzumachen, dass die Freund:innenschaft auch unabhängig von der neuen Liebesbeziehung einen hohen Eigenwert besitzt. Lasst uns mutig sein und mehr Verantwortung füreinander übernehmen!
Bock auf mehr STROBO? Lest hier: Musik ist ihr Ventil: Johama im Porträt.